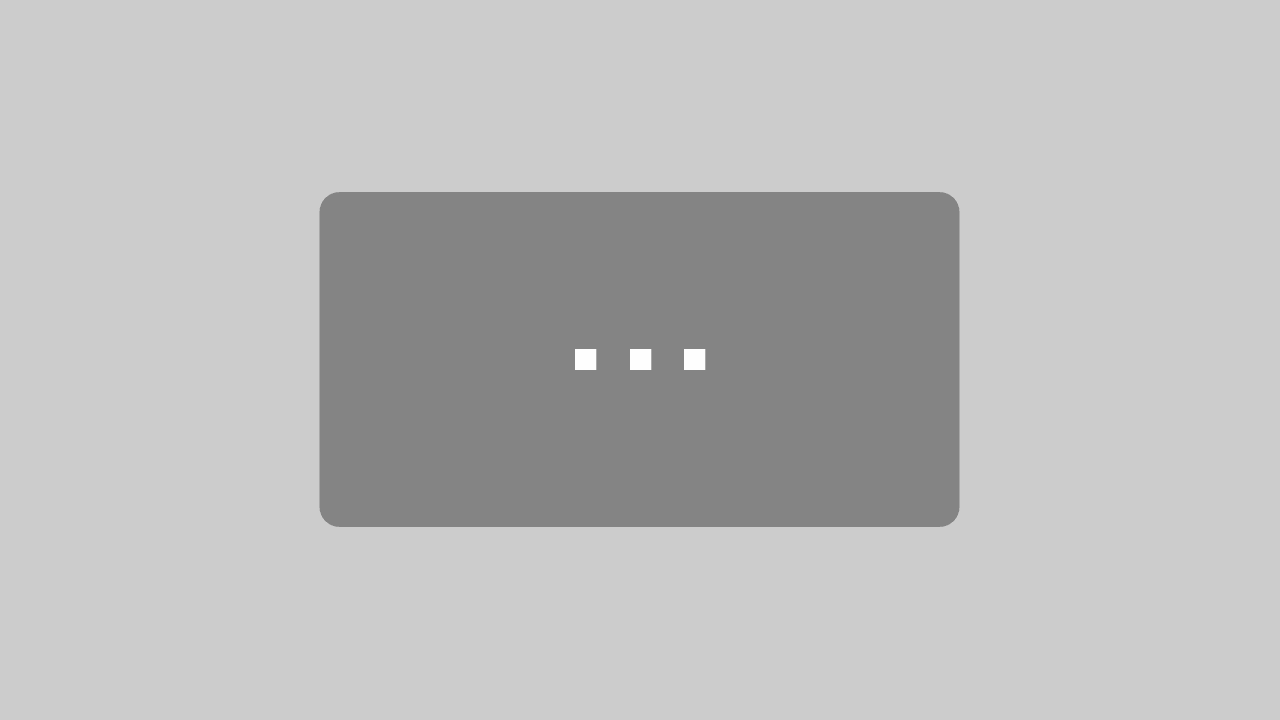Region Stuttgart
Die Region Stuttgart ist die geographische, wirtschaftliche und politische Kernregion des Landes Baden-Württemberg. Bekannt ist sie für ihre Wirtschaftskraft, als Wiege des Automobils, Heimat zahlreicher Global Player und innovativer Mittelständler. Doch auch landschaftlich hat sie einiges zu bieten: Entlang des Neckar wechseln sich industrielle Zentren mit von Wäldern, Wiesen und Weinbergen geprägten Landschaften ab. Um die hohe Lebensqualität in der Region Stuttgart aufrecht zu erhalten, arbeiten ihre Akteur*innen Hand in Hand.
mehr dazu
Wirtschaftsstandort
Die Region Stuttgart ist eines der stärksten Wirtschaftszentren Europas, Hochtechnologiestandort und verfügt über eine erstklassige Forschungsinfrastruktur. Internationale Großkonzerne tragen ebenso zur Qualität des Standortes bei wie die zahlreichen kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von denen viele weltweit führend in ihrem Bereich sind.
Aktuelles aus der Region Stuttgart

Im Gin-Himmel
Einer der besten Gins der Welt kommt aus der Region Stuttgart. Die Gin-Marke Ginstr ist jetzt mit der Goldmedaille beim ...

Die Welt zu Gast in der Region Stuttgart
In der Region Stuttgart haben deutlich mehr Menschen übernachtet als noch im Vorjahr. Besonders viele Besucher*innen kommen aus den USA

Starke Fasern für leichtes Wandern
Die Firma Leki aus Kirchheim hat den weltweit ersten Wanderstock aus Hanf entwickelt. Angebaut wird die Pflanze in direkter Umgebung

Tauchgang in eine neue Welt
Die Imsys GmbH & Co. KG aus Leonberg bringt Unternehmen in eine virtuelle Welt. Von großen Autos bis Maschinen in ...

Wissenschaftsstandort
Mit zahlreichen Universitäten und Forschungsinstituten verfügt die Region Stuttgart über eine exzellente Forschungslandschaft, die eng mit der ansässigen Industrie kooperiert. Denn auch die Unternehmen der Region arbeiten an Technologien der Zukunft: nirgendwo sonst in Baden-Württemberg wird so viel in Forschung- und Entwicklung investiert wie hier.
179 Kommunen,
fünf Landkreise und eine Landeshauptstadt.
Die Region Stuttgart im Portrait.

Politik und Organisation
Was ist die Region Stuttgart? Wie ist sie organisiert? Welche Aufgaben hat der Verband Region Stuttgart? Hier gibt es die Antworten.
mehr dazu
Infrastruktur
Ob Straße, Schiene, Luft oder Wasser:
Die Region Stuttgart ist in Europa bestens vernetzt.

Wohlfühlstandort
Bei der Lebensqualität nimmt die Region Stuttgart in internationalen Umfragen regelmäßig einen Spitzenplatz ein. Eine lebendige Vereinskultur, die aktive Kunst- und Musikszene und idyllische Landschaften direkt vor der Haustür machen die Region zu einem außergewöhnlich attraktiven Ort zum Leben. Neuankömmlinge, egal ob aus Deutschland oder der ganzen Welt, werden hier mit offenen Armen empfangen und beim Ankommen unterstützt.

#SoistS – Die digitale Plattform für die Region Stuttgart
Unter dem Hashtag #SoistS bündeln wir das Lebensgefühl der Region Stuttgart und zeigen gemeinsam mit Menschen, die hier leben und arbeiten, was unsere Heimat zu etwas ganz Besonderem macht.
So ist S